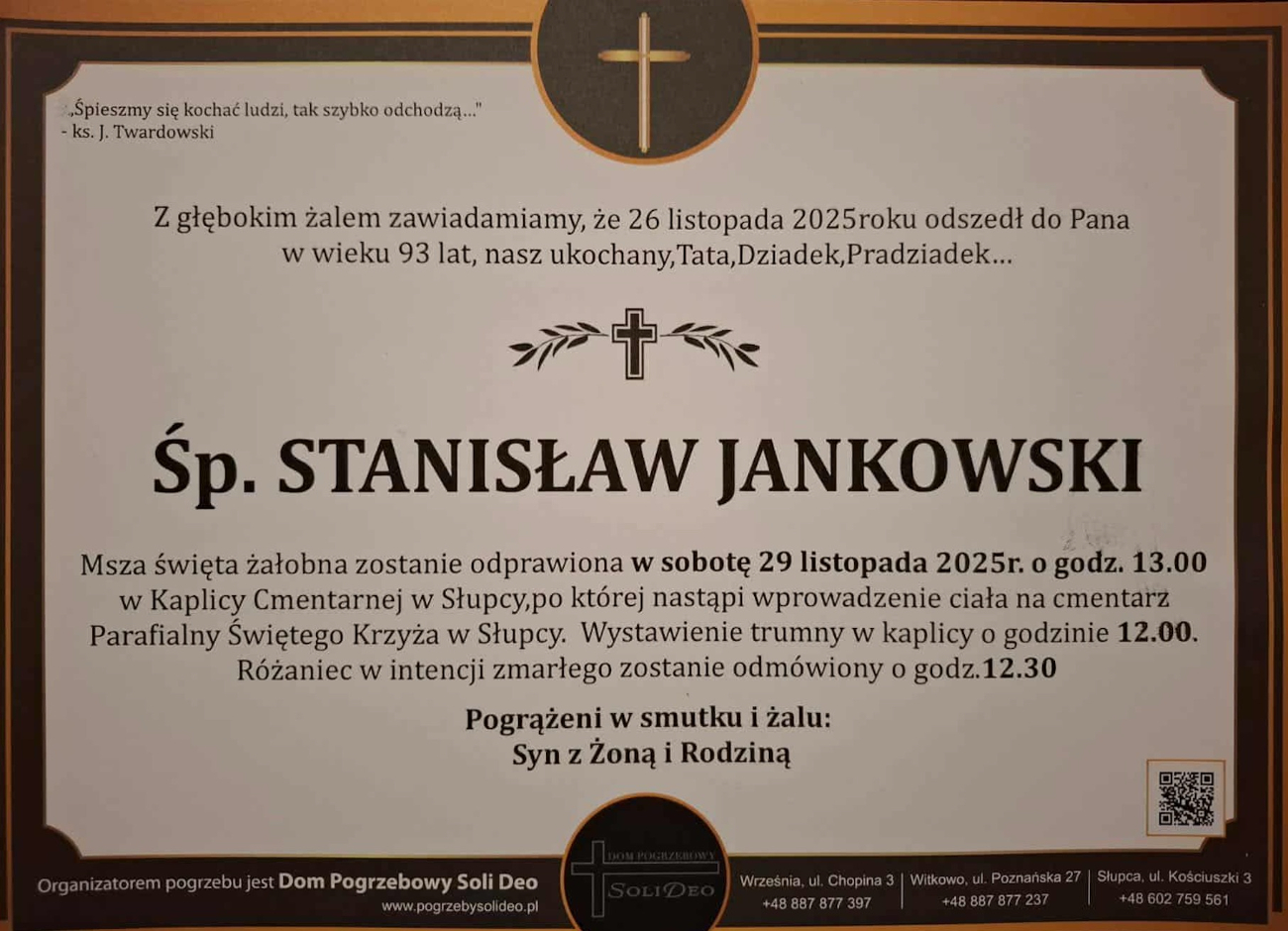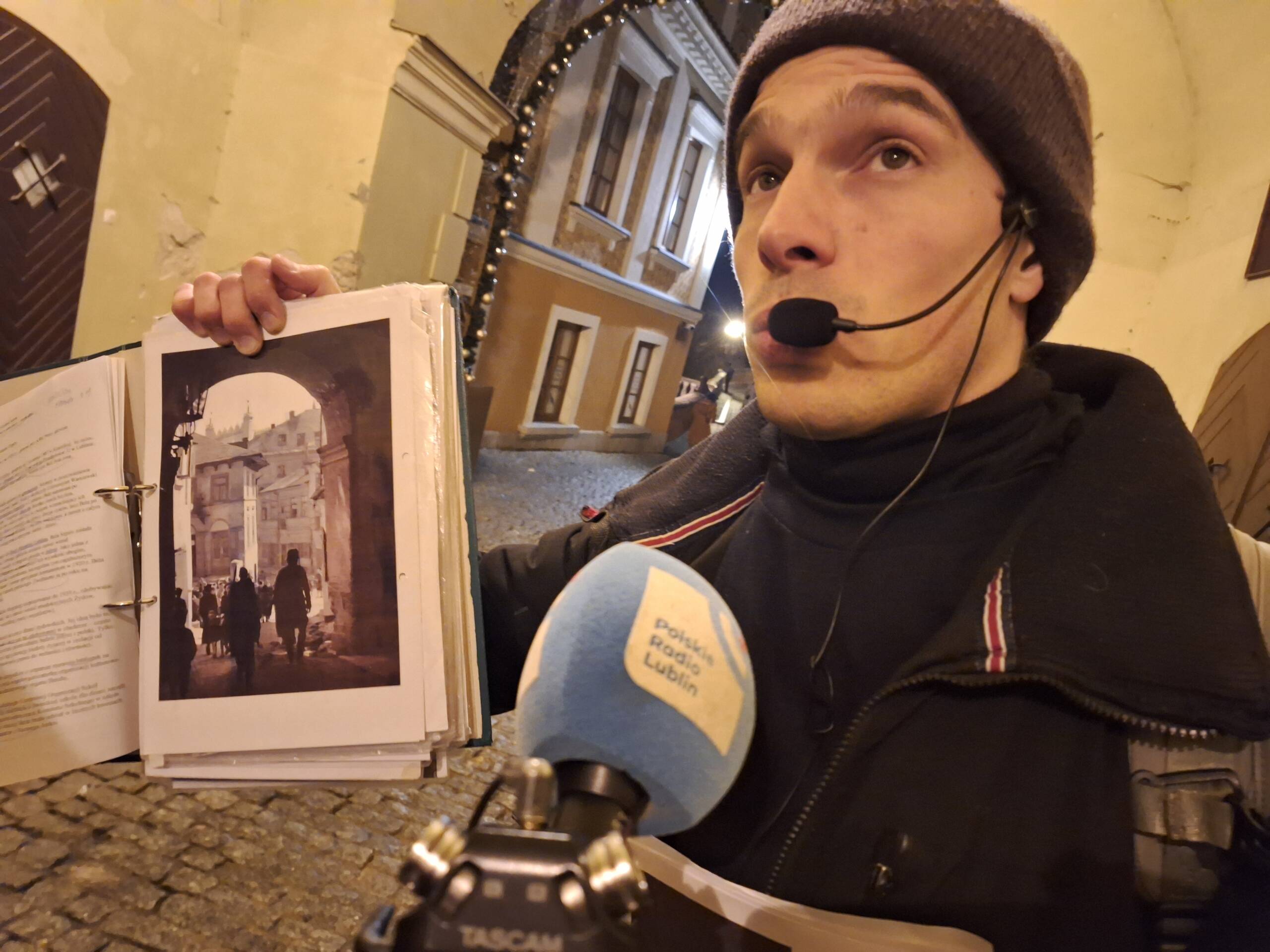Erinnerungen, die nicht verstummen: Wie Nachkommen von Vertriebenen mit den Spuren von Flucht und Heimatverlust leben
Mehr als zehn Millionen Menschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihren Heimatorten in Mittel- und Osteuropa vertrieben. Diese Erfahrung prägte nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder – die sogenannte „zweite Generation“. In dem von Roswitha Schieb und Rosemarie Zens herausgegebenen Band „Zugezogen: Flucht und Vertreibung – Erinnerungen der zweiten Generation“ kommen genau diese Kinder zu Wort: Menschen, die zwar selbst nicht vertrieben wurden, aber dennoch mit der Last der Vergangenheit aufwuchsen.
In Essays, Gedichten, Interviews und Kurzprosa gewähren deutsche und polnische Autor:innen Einblick in fragmentierte Familiengeschichten, die Suche nach Identität und ambivalente Gefühle gegenüber Orten, Sprachen und Herkunft.
„Die Fremden sind wir selber“, bringt es Barbara Lehmann prägnant auf den Punkt – ein Satz, der wie ein Leitmotiv über vielen der Texte steht.
Zwischen Entwurzelung und neuer Verwurzelung: Heimat als offene Frage
Die Anthologie zeigt, wie vielschichtig und oft widersprüchlich die Nachwirkungen von Vertreibung erlebt werden. Im Spannungsfeld zwischen Heimatverlust und der Suche nach einem neuen Ort entsteht eine fragile Identität.
So beschreibt Jenny Schon das anhaltende Gefühl, nie wirklich anzukommen und „irgendwie immer fehl am Platz“ zu sein. Joachim Schieb wiederum versucht, die Leerstelle der Nichtzugehörigkeit durch familiären Zusammenhalt zu füllen. Er bewahrt sich daher „lange Wurzeln, Luftwurzeln und Offenheit“ – ein Bild, das Stabilität und Beweglichkeit zugleich in sich trägt.
Noch radikaler klingt die Perspektive von Martin Jankowski, der sich von tradierten Herkunftsvorstellungen bewusst löst: „Ich habe keine Wurzeln, ich habe zwei Beine.“
Dieser Satz steht sinnbildlich für eine Identität, die sich nicht über Herkunft, sondern über Offenheit und Bewegung definiert – eine produktive Haltung, die aus dem Bruch erwächst.
Gleichzeitig bleibt oft ein Gefühl zurück, das sich kaum benennen lässt – ein unstillbarer Schmerz, der sich tief ins Gedächtnis eingeschrieben hat: „Der Mensch, der seinen Ort verlassen muss, gibt einen wesentlichen Teil seiner selbst auf. Phantomschmerzen werden ihn bis ans Lebensende quälen.“ Es ist dieser unsichtbare Verlust, der wie ein leiser Unterton viele der Texte durchzieht.
 Roswitha Schieb und Rosemarie Zens: „Zugezogen: Flucht und Vertreibung – Erinnerungen der zweiten Generation“
Roswitha Schieb und Rosemarie Zens: „Zugezogen: Flucht und Vertreibung – Erinnerungen der zweiten Generation“Vererbte Wunden: Die Last der Erinnerung
Das Buch verdeutlicht eindrucksvoll, wie sich die Traumata der Eltern auf ihre Kinder übertragen – nicht nur emotional, sondern auch körperlich.
„Traumatisierungen […] können sich laut aktueller Genforschung durch Epigenetik von der Erlebnisgeneration auf die nächste Generation vererben.“ Diese Erkenntnis erhält in den literarischen Stimmen der zweiten Generation ein konkretes Gesicht.
Oft ist es gerade das Schweigen, das am lautesten wirkt. Barbara Lehmann spricht von Familiengeschichten, die nur in „Fetzen“ überliefert wurden.
Katarzyna Turaj-Kalinska erzählt von Identitätsverlust und Sprachverwirrung – Erfahrungen, die aus dem Fehlen klarer Narrative entstanden.
So entsteht ein Zustand, der fast unwirklich wirkt: ein kollektiver Gedächtnisverlust, der auch gesellschaftlich spürbar ist. „Die Erinnerung an Schlesien sollte möglichst schnell aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwinden“ – das Thema Flucht und Vertreibung war nicht nur in der Sowjetischen Besatzungszone, sondern auch in der DDR tabu. Flüchtlinge und Vertriebene wurden als „Umsiedler“ bezeichnet, ab 1950 dann als „Neubürger“.
Auch aktuelle Studien zeigen: Die Erinnerung an die ehemaligen Ostgebiete ist bei vielen nach 1980 Geborenen nicht nur marginalisiert, sondern häufig völlig unbekannt.
Zugehörigkeit in mehreren Sprachen: Die deutsche und die polnische Perspektive
Besonders stark ist das Buch dort, wo es auch polnische Perspektiven einbezieht. Denn nicht nur Deutsche wurden aus Schlesien vertrieben – auch viele Pol:innen mussten ihre Heimat in Ostpolen verlassen. Die Parallelen sind unübersehbar: Während über diese Themen im sozialistischen Polen kaum öffentlich gesprochen werden durfte, blieb das Schweigen in den Familien dennoch durchlässig.
Wo Worte fehlen, spricht die Stille: Wenn das Schweigen der Eltern zur lautesten Stimme wird.
Ein Zitat des polnischen Dichters Adam Zagajewski bringt das innere Dilemma der zweiten Generation eindringlich auf den Punkt: „Es ziemte sich nämlich nicht, hier, in dieser zufälligen Stadt, die Welt schön zu finden.“ Dahinter verbirgt sich ein Gefühl der Entwurzelung, das auf beiden Seiten spürbar ist – egal, welche Sprache gesprochen wird.
Gerade diese interkulturelle Öffnung zeigt: Vertreibung, Verlust und Identitätskonflikte sind keine nationalen Phänomene – sie sind universelle menschliche Erfahrungen. Und gerade in dieser Gemeinsamkeit liegt das Potenzial für Verstehen und Versöhnung.
Von der Vergangenheit lernen: Erinnerung als Zukunftsarbeit
Das Buch ist weit mehr als nur eine Sammlung persönlicher Geschichten. Es ist ein kollektives Erinnerungsprojekt, das versucht, Geschichte zu erzählen, ohne sie zu verhärten.
Rosemarie Zens fasst diese Haltung in einem Satz zusammen, der offen lässt, was daraus wird – Trennung oder Annäherung: „Wir bleiben uns fremd, wir rücken einander näher.“
Auch der Erinnerungsort selbst – in Zens’ Lyrik das Meer, insbesondere die Ostsee – wird zur „Metapher des Erinnerns und Vergessens“. Es steht für das, was verborgen ist, verdrängt, aber nie ganz verschwunden – für das Unbewusste, das sich zwischen den Generationen weiterträgt.
Die Vergangenheit lässt sich nicht ungeschehen machen. Aber sie lässt sich befragen. Und vielleicht ist das die wichtigste Botschaft dieses Buches: Erinnerung muss keine Last sein. Sie kann eine Brücke sein – zu mehr Verständnis, Mitgefühl und Verantwortung in einer Welt, in der Flucht und Vertreibung noch immer bittere Realität sind.
Das Buch wurde 2016 vom Ferdinand Schöningh Verlag veröffentlicht. Erhältlich ist es unter anderem auf Amazon: https://www.amazon.de/Zugezogen-Vertreibung-Erinnerungen-zweiten-Generation/dp/3506785702