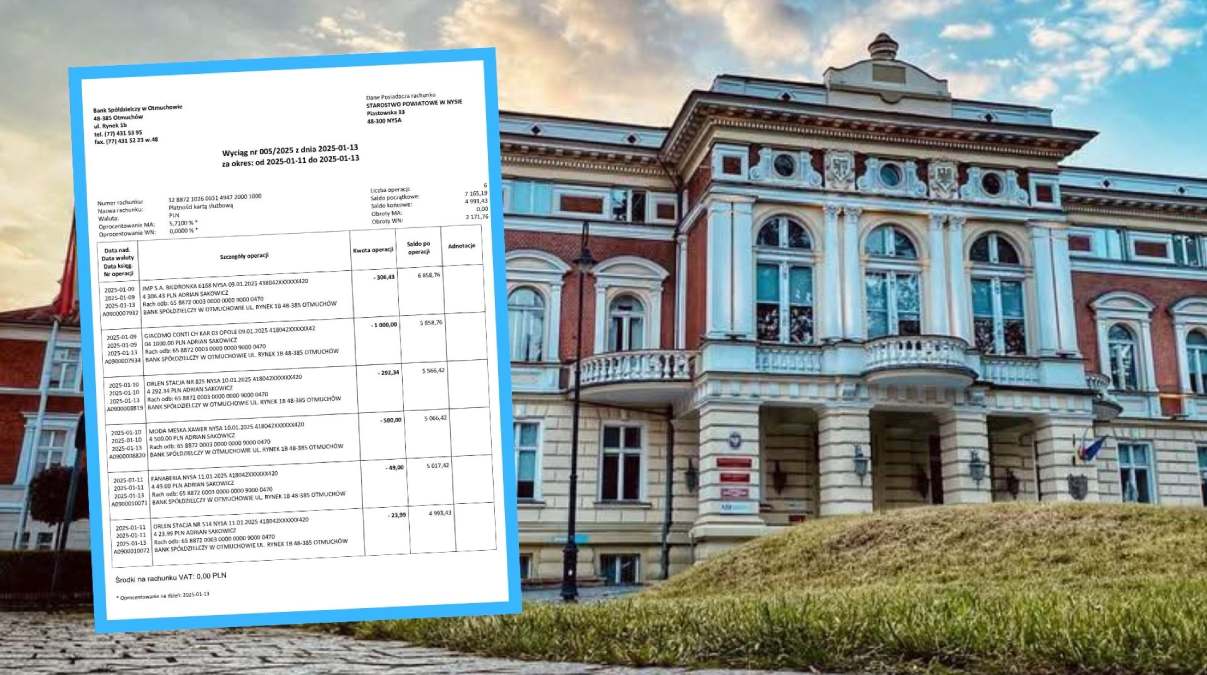Eine schlesische Spezialität – die Defenestration
Ein polnischer Regisseur bezeichnete die Schlesier als Einfaltspinsel, und auch ein Politiker aus der Woiwodschaft Oppeln gebrauchte dieses Wort. Das stimmt jedoch nicht. In Schlesien wurde eine Technik zur Führung sozialer Auseinandersetzungen entwickelt, die aufgrund ihrer Auswirkungen in allen europäischen Geschichtsbüchern zu finden ist.
Defenestration, also Fenstersturz, bedeutet, jemanden aus dem Fenster zu werfen. Damit es zu einem solchen Ereignis kommt, bedarf es einer großen Demonstration, die aus tiefer Erregung, einem wichtigen Anliegen für die Menschen und großer Anspannung resultiert. In der Geschichte werden drei solcher Ereignisse erwähnt.
Marsch zum Rathaus
Als die Anträge auf Beteiligung der Zünfte an der Arbeit des Stadtrats abgelehnt wurden, marschierten die Tuchmacher und Metzger zum Rathaus. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, warfen sie den Bürgermeister und mehrere Ratsherren aus dem Fenster – direkt auf die Speere der Rebellen, die unten warteten. Einige weitere wurden mit dem Schwert hingerichtet, das die Stadt – nach Prag die zweitwichtigste – vom böhmischen König erhalten hatte. Anschließend wurde ein neuer Stadtrat gewählt, dem neben den Reichsten auch Handwerker angehörten.
Defenestration, also Fenstersturz, bedeutet, jemanden aus dem Fenster zu werfen
Doch nach zwei Jahren wendete sich das Blatt. Im Jahr 1420 eroberte der böhmische, ungarische und römische König sowie deutsche Kaiser Sigismund von Luxemburg Breslau und ließ 20 Rebellen enthaupten. Ihre Köpfe wurden auf die Stadtmauern gelegt, ihre Leichen unter der Straße begraben, die zur St.-Elisabeth-Kirche führte. Die Beteiligung der ärmeren Schichten am Stadtrat wurde jedoch beibehalten.
Namen, die Angst einjagten
Am 30. Juli 1419 drangen Anhänger des 1415 in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannten Prager Universitätsprofessors Jan Hus in das Rathaus der Prager Neustadt ein und versuchten, ihre Glaubensgenossen zu befreien. Sie warfen den Bürgermeister und neun weitere Personen aus dem Fenster, wo sie von einer bewaffneten Menschenmenge erwartet wurden, die sie anschließend tötete. Dies war der Beginn der Hussitenkriege, und die Namen der Organisatoren – Pfarrer Jan von Seelau (Želivský) und Jan Žižka – jagten ganz Mitteleuropa Angst ein.
Wunder im Misthaufen
Ein weiteres solches Ereignis ereignete sich in Prag, als protestantische böhmische Adlige zum Vertreter des Kaisers – einem Katholiken – kamen, um gegen die Verletzung der Religionsfreiheit zu protestieren, insbesondere gegen die Zerstörung zweier protestantischer Kirchen. Die Emotionen eskalierten während des Gesprächs so sehr, dass der Statthalter und zwei weitere Beamte aus dem Fenster geworfen wurden – ähnlich wie in früheren Fällen. Doch es geschah ein Wunder: Die Fallenden blieben unverletzt, da sich unten ein Misthaufen befand.
Kleiner Streit – grausamer Krieg
So begann am 23. Mai 1618 der Dreißigjährige Krieg. Aus einem kleinen Streit um zwei Kirchen entbrannte ein Krieg, in den mehr oder weniger alle europäischen Länder finanziell, militärisch und diplomatisch involviert waren. Schlesien unterstützte zunächst die Protestanten. In Niederschlesien starben in einigen Orten sogar bis zu zwei Drittel der Einwohner während dieser dreißig Jahre.
Es war eine schreckliche, hoffnungslose Zeit. Ein einmaliger sozialer Aufstand wäre schnell erloschen, doch es gab stets Investoren, die bereit waren, erhebliche Mittel für die Kriegsführung bereitzustellen – Eisen, Gold, Menschen und Pferde. Die Armee versorgte sich selbst mit Lebensmitteln und Kleidung und zerstörte dabei Vermögen, Land, Werkzeuge und andere Güter, die für das Leben und die Entwicklung der Region notwendig waren.








![Świdnica w świątecznej miniaturze. Wybrano najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe [FOTO]](https://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2025/12/Swidnicka-Szopka-Bozonarodzeniowa-rozstrzygniecie-konkursu-2025.12.19-78.jpg)






![Ponad 340 mln zł! Historycznie wysoki budżet powiatu płockiego. Ogromna kwota środków na inwestycje [FOTO]](https://dziennikplocki.pl/wp-content/uploads/2025/12/IMG_6062-1-Medium.jpg)