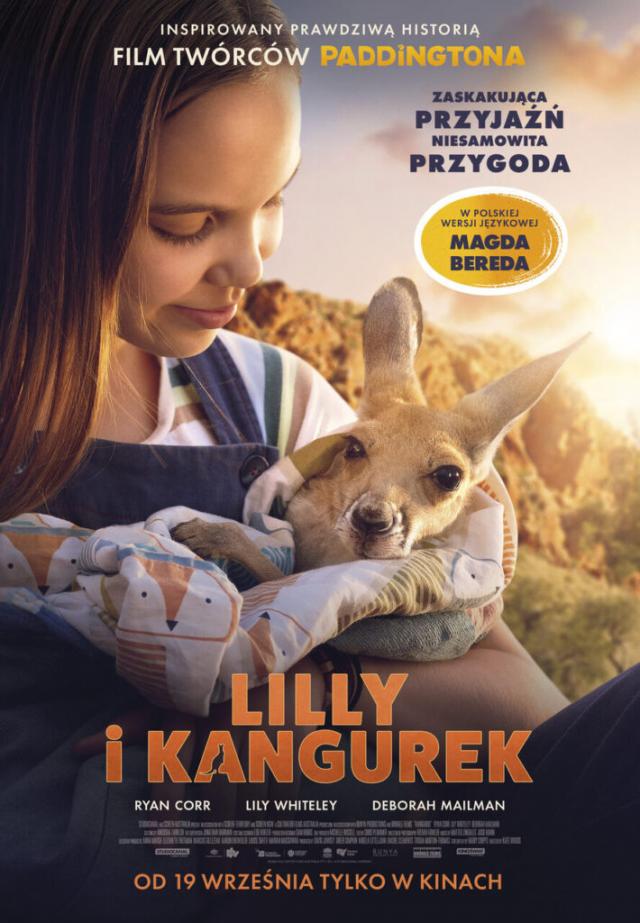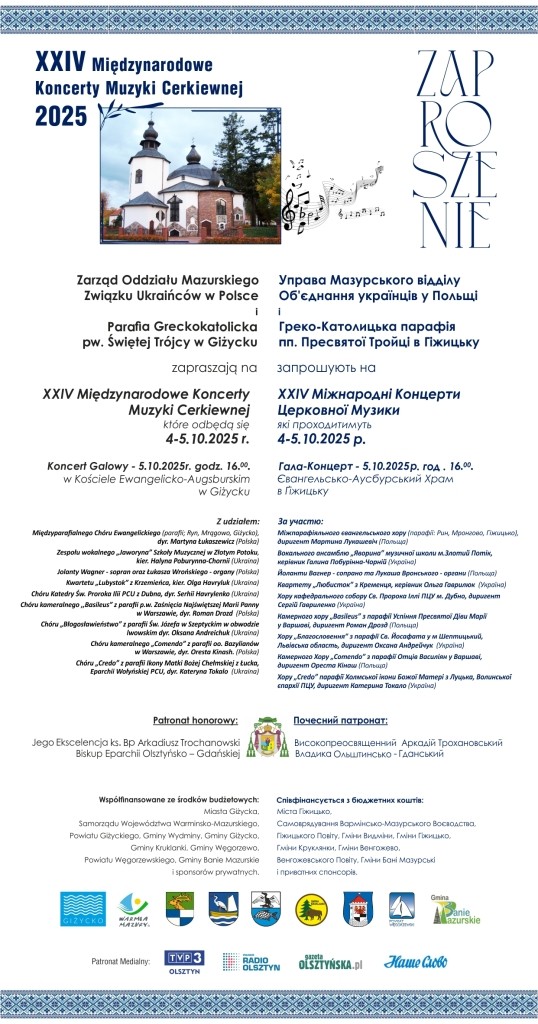Die deutsch-polnische Freundschaft und wie ich sie erlebte
Es war im Jahre 1973, ich besuchte mit meinem Bruder Günther zusammen meine verloren geglaubte oberschlesische Heimat, die ich vor 27 Jahren als zwölfjähriges Kind, wegen der russischen Front verlassen hatte. Als Heimat kannte ich nur meine Geburtsstadt Zülz mit ihrer näheren Umgebung, unsere Kreisstadt Neustadt, Arnoldsdorf am Fuße der Bischofskoppe und Otmut an der Oder, da begleiteten wir Kinder die Zülzer Fußballmannschaft zu einem Spiel, sonst hatte ich von meiner Heimat nichts gesehen.
 Von links: Heinz Barisch, Michael Kalb, Günther Barisch
Von links: Heinz Barisch, Michael Kalb, Günther BarischFoto: Pressestelle Stadt Bobingen
Wir waren wie Gefangene in unserer historischen Stadtmauer. Meine Eltern gingen von Montag bis Sonnabend in die Arbeit. Für Reisen, Urlaub und Freizeit hatten sie mit vier Kindern damals in den 30er und 40er-Jahren keine Zeit und kein Geld. Das einzige Transportmittel, das nichts kostete, war Vaters Fahrrad, das er täglich für die Fahrt zu seiner Arbeitsstätte in Neustadt benötigte. Es war für uns Kinder im Vergleich mit den Kindern der „Neuen Zeit“, die heute mit dem „Jumbo-Jet“ ferne Länder vor Ort erkunden können, eine Zeit, in der wir die Welt nur aus dem Schulatlas und da auch nur Europa kennenlernten.
Sehnsucht nach Oberschlesien
Umso größer war die Sehnsucht, unser wunderschönes Oberschlesien endlich einmal näher kennenzulernen, und das taten mein kürzlich verstorbener Bruder und ich in der Zeit von 1973 bis 2018 circa 20-mal. Es war eine lange Zeit, denn aus uns Kindern sind nach dieser Zeit Familienväter geworden. Bei jedem Besuch, den wir in unsere Heimatstadt Zülz unternahmen, haben wir unser Oberschlesien erkundet. Es waren Oppeln mit dem Annaberg, das prächtige Schloss Moschen mit seinen 96 Türmen und Türmchen, die Nachbarstädte Oberglogau, Neustadt, Neisse und nicht zuletzt unseren Hausberg, die Bischofskoppe mit dem tollen Aussichtsturm, von dem aus man tief ins Oberschlesische Land blicken konnte und das am Fuße der Bischofskoppe gelegene Naturfreibad Wildgrund.
 Eine Postkarte aus Zülz
Eine Postkarte aus ZülzQuelle: Wikipedia
Große Unterstützung fanden wir dabei bei der Familie Barysz aus Zülz, unseren engsten Freunden aus der Kinderzeit. In deren Heim durften wir all die Jahre unseren Heimaturlaub verbringen und alte Erinnerungen wieder ins Leben zurückholen. Diese Besuche in der Heimat waren ständig Begegnungen der Freundschaft mit den „Neu-polnischen“ Bürgern.
Warum „Neu-polnisch“?
In dem Gebiet Oberschlesien sind viele deutsche Bürger nach dem Einmarsch der russischen Truppen, im Gegensatz zu den Flüchtenden, die ihr Heil in einer Neuen Heimat suchten, in ihre Wohnungen und Besitztümer zurückgekehrt. Vor allem die Landwirts-Frauen mit ihren Kindern im Oppelner Bezirk wollten ihre Höfe nicht aufgeben und warteten auf die Rückkehr der Väter und älteren Söhne, die als Soldaten an der Front waren, um ihre „Scholle“, die seit Jahrhunderten den Familien gehörten, weiter zu bearbeiten. Der polnische Staat bekam dieses deutsche Gebiet von den alliierten Siegermächten unter seine Verwaltung zugeteilt.
 Stadt Zülz, als 1945 die Rote Armee 1945 einmarschierte.
Stadt Zülz, als 1945 die Rote Armee 1945 einmarschierte.Quelle: Wikipedia/ Aleksander Ustinow, „Prudnik – historia fotografią pisana”, Ryszard Kasza
Erst mit den Ostverträgen und dem Verzicht Deutschlands auf Rückführung der Ostgebiete und der Anerkennung der Oder-Neiße Grenze wurde auch unser deutsches Oberschlesien zu Polen gehörig. Natürlich wurde schon gleich nach 1945 das Deutschtum in den Ostgebieten durch Polen zu verwischen versucht. Man scheute nicht davor zurück, aus den Grabsteinen und Schrifttafeln die deutsche Identität heraus zu meißeln. Die deutsche Sprache wurde verboten, in der Schule wurde nur Polnisch gesprochen, die deutschen Bürger wurden diskriminiert. Es wurden polnische Pässe für die Deutschstämmigen eingeführt und auch die Namen der Familien wurden geändert, so wurde aus dem Namen unserer Freunde Barisch der polnische Name „Barysz“. Das alles aber konnte nicht verhindern, dass das Deutschtum in Oberschlesien heute noch gepflegt wird. In den Grenzgebieten Schlesiens wurden die die Deutschen von ihren Bauernhöfen vertrieben, Polen übernahmen die Bauernhöfe und die ehemaligen Besitzerfamilien, wenn sie noch im Hause weiter wohnen wollten, wurden in beengte Räumlichkeit zurückgedrängt und mussten sich ihr Dasein mühevoll im eigenen Hof von den neuen Besitzern erarbeiten.
Wunden des Heimatverlustes geheilt
Doch Polen und Deutsche sind in den langen Jahren des Nebeneinanders zu Freunden geworden, die sich schätzen und achten. Was uns, die Älteren, die noch vor 1945 in der Heimat gelebt haben, betrifft, hat die Zeit bei den meisten die vorhandenen Wunden des Heimatverlustes geheilt. Ein besonderes Erlebnis hatten mein Bruder und ich während eines Besuches in den 70er-Jahren in unserer Heimatstadt. Bei der Rückfahrt von Zülz, an der Görlitzer Grenze, hatten wir im Kofferraum unseres Autos auch einige Antiquitäten vom Bauernhof unseres Freundes als Mitbringsel geladen.
Polen und Deutsche sind in den langen Jahren des Nebeneinanders zu Freunden geworden, die sich schätzen und achten.
Dabei handelte es sich um ein altes Pferdekummet nebst Peitsche, Dreschflegel und eine alte Milchkanne, diese Dinge waren damals sehr beliebt als Sammelobjekte. Natürlich mussten wir den Kofferraum zur Kontrolle öffnen. Einer der polnischen Grenzsoldaten schmunzelte, als er diese Dinge sah. Vor allem der Dreschflegel hatte es ihm angetan. Er nahm ihn heraus und zeigte ihn den anderen Grenzsoldaten, indem er mit dem bäuerlichen Gerät so tat, als würde er mit schlagenden Bewegungen das Korn dreschen. Er war wohl auch Bauer und wusste das Gerät zu bedienen. Nun probierten es unter lautem Gelächter einer nach dem anderen mit mehr oder weniger Können. Nachdem das Korn gedroschen war, gaben sie uns den Dreschflegel zurück und wir konnten unsere Fahrt bis zu den Grenzern der DDR, die uns, im Gegenteil zu den Polen, wie üblich mit Schikanen wie ihre Feinde behandelten, fortsetzen.
Nach diesem lustigen Erlebnis an der polnischen Grenze wussten wir Brüder, dass es für uns Zwei der Beginn der deutsch – polnischen Freundschaft war.
Mit heimatlichen Grüßen
Heinz Barisch
Die Gebrüder Barisch
 Heinz Barisch hat seine Erinnerungen in seiner Autobiographie „Verlorene Heimat. Odyssee einer Flüchtlingsfamilie“ aufgeschrieben.
Heinz Barisch hat seine Erinnerungen in seiner Autobiographie „Verlorene Heimat. Odyssee einer Flüchtlingsfamilie“ aufgeschrieben.Quelle: Heinz Barisch
Heinz Barisch hat seine Erinnerungen an die Kindheit in Oberschlesien und Flucht nach Deutschland, als er 12 Jahre alt war, in seiner Autobiografie „Verlorene Heimat. Odyssee einer Flüchtlingsfamilie“ aufgeschrieben.
Mit fast 90 Jahren begab sich Heinz Barisch auf die Reise in seine Heimat Zülz. Begleitet wurde er dabei vom Regisseur Michael Kalb. Dieser drehte den Dokumentarfilm „Die letzten Zeitzeugen“, in dem die Gebrüder Barisch ihre Lebensgeschichte erzählen.
Günther Barisch ist 2023 verstorben.
Fernsehauftritt
Anlässlich des 80 jährigen Endes des Zweiten Weltkrieges wird am 7. 5. 2025 um 22.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen der Film “Die Letzten Zeitzeugen”, an dem die Brüder Barisch mitgewirkt haben, gezeigt.
Hier geht es zum Programm Kalender des Bayrischen Rundfunks: https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/sendung-3757630.html
Hier geht es zum FB Beitrag von Heinz Barisch zum Film: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3944601325868404&set=a.2153527638309124

![BIESZCZADY: Spacer edukacyjny uczniów na Bukowym Berdzie [ZDJĘCIA]](https://esanok.pl/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/2dnk0k.jpg)