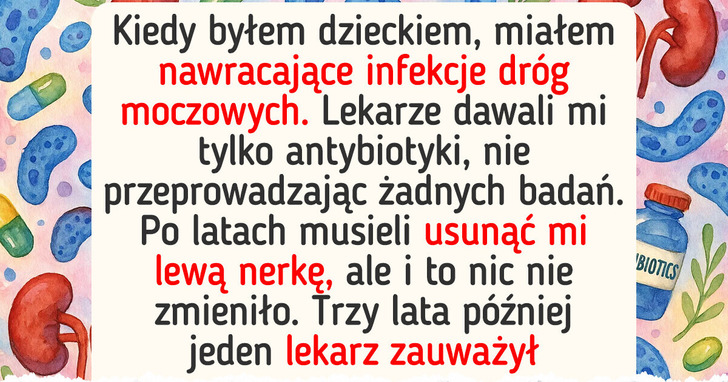Wie entwickelt sich die Identität von Menschen, die sich nach 1945 zwischen Polen, der BRD und der DDR wiederfanden? Ist Nationalität etwas, das man „mitnehmen“ kann, oder unterliegt sie ständig neuen Verhandlungen? Wie beeinflusst die Erinnerung an die Vergangenheit – sowohl individuell als auch kollektiv – die Art und Weise, wie wir heute über Migration und Vertreibung sprechen?
Auf diese Fragen wird Prof. Ryszard Kaczmarek während eines vom Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit organisierten Gesprächs antworten. Die Veranstaltung findet am 4. Dezember 2025 um 17:00 Uhr im Dokumentations- und Ausstellungzentrum der Deutschen in Polen, Szpitalna 11, Oppeln, statt.
Prof. Kaczmarek ist ein herausragender Forscher der Geschichte der Oberschlesischen Deutschen, der Nachkriegswanderungen und der polnisch-deutschen Beziehungen. Sein neuestes Buch „Bin ich Deutscher? Vertriebene aus Polen in die BRD und DDR 1950–1991“ (Wydawnictwo Literackie, 2025) gilt als eine der wichtigsten zeitgenössischen Analysen der Erfahrungen von Menschen, die zwischen zwei deutschen Staaten, unterschiedlichen politischen Systemen und verschiedenen historischen Narrativen lebten.
Das Gespräch wird sich mit Erinnerung als Quelle von Identität, dem Durchbrechen von Schweigen in Familien, schwierigen Rückkehrerfahrungen zu den eigenen Wurzeln sowie der Frage beschäftigen, wie die komplexen biografischen Wege der Bewohner des ehemaligen polnisch-deutschen Grenzgebiets heute zu einer wichtigen Stimme in der Debatte über die Geschichte und Gegenwart der Region werden.
Während der Veranstaltung werden die Teilnehmer sowohl die Dramen einzelner Biografien als auch größere gesellschaftliche Prozesse kennenlernen: Nachkriegswanderungen, die Politik gegenüber Vertriebenen, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung in der BRD und DDR sowie den Einfluss der deutschen Erinnerungskultur auf die Darstellung der Geschichte Schlesiens und der Schicksale von Familien, deren Identität ständig äußeren Definitionen unterworfen war.
Das Gespräch wird sich mit Erinnerung als Quelle von Identität, dem Durchbrechen von Schweigen in Familien, schwierigen Rückkehrerfahrungen zu den eigenen Wurzeln sowie der Frage beschäftigen, wie die komplexen biografischen Wege der Bewohner des ehemaligen polnisch-deutschen Grenzgebiets heute zu einer wichtigen Stimme in der Debatte über die Geschichte und Gegenwart der Region werden.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für die Geschichte der Deutschen in Polen, das Thema Vertreibung, die Geschichte Oberschlesiens, kollektive Erinnerung und den polnisch-deutschen Dialog interessieren – einschließlich Lehrer, Studierende, Forschende und Journalist*innen.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Kontakt: [email protected] | 503 721 658
Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) über den Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) gefördert.