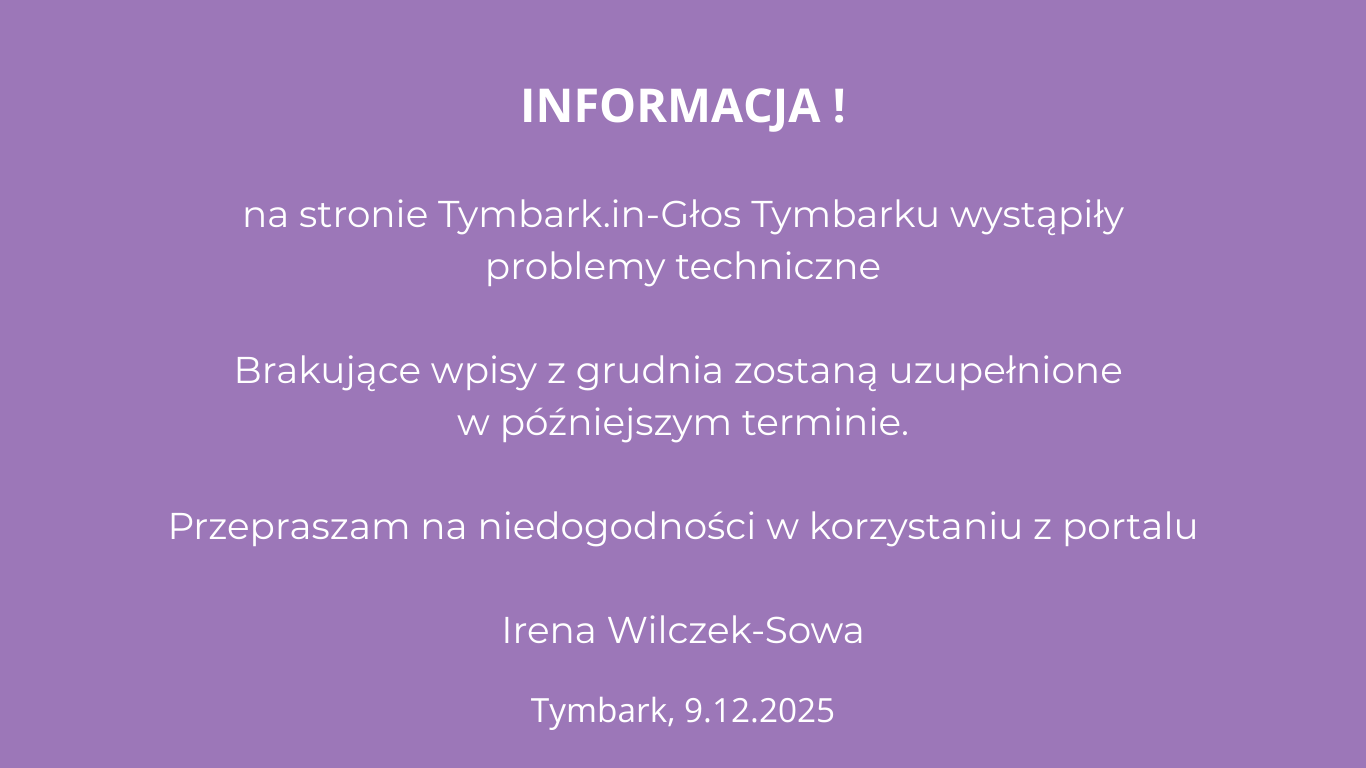Warum verdient Jennifer weniger als John, obwohl sie den gleichen Lebenslauf hat? Warum erhalten Frauen oftmals weniger Anerkennung – bei derselben Verantwortung? Und was hat das mit unserem Hirn zu tun? Eine Spurensuche zwischen Gender Pay Gap, Rollenbildern und den Einflüssen von Sozialisation – mit Fakten aus dem Buch „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit” von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim.
Gleich qualifiziert – ungleich bezahlt
In ihrem zweiten Buch nimmt Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim einige der größten gesellschaftlichen Streitfragen unter die Lupe – darunter auch den Gender Pay Gap. Ihr Befund: Die Lohnlücke ist real und lässt sich auch wissenschaftlich nicht wegdiskutieren.
Im Jahr 2020 lag die unbereinigte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei 19 %. Diese Zahl vergleicht das Durchschnittsgehalt aller Frauen mit dem aller Männer – ohne Unterschiede bei Job, Arbeitszeit oder Position zu berücksichtigen. Die bereinigte Lohnlücke, die genau diese Faktoren (z. B. gleiche Berufe, gleiche Arbeitszeiten, gleiche Qualifikationen) einbezieht, liegt bei 6 %. Das bedeutet: Selbst bei vergleichbaren Voraussetzungen verdienen Frauen im Schnitt immer noch weniger – ein „unerklärter Rest“, der auf strukturelle Ungleichheiten hinweist.
Eine Studie aus den USA, auf die Nguyen-Kim verweist, wurde im Bereich der Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) an der Cornell University durchgeführt – und zeigt dies eindrücklich:
Bei identischen Lebensläufen bewerteten Professor:innen „Jennifer“ als weniger kompetent als „John“, was sich auch in einem geringeren Einstiegsgehalt widerspiegelte. Anders ausgedrückt: John wurde ein durchschnittliches Gehalt von 30.000 € vorgeschlagen, Jennifer hingegen nur 26.500 €.
 “Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit” von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
“Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit” von Dr. Mai Thi Nguyen-KimGleich klug – aber nicht gleich eingeschätzt
IQ-Tests zeigen: Männer und Frauen sind im Schnitt gleich intelligent. Intelligenz wird dabei von vielen Faktoren beeinflusst, unter anderem von den Lebensumständen. Dennoch trauen sich Männer in der Regel mehr zu. Das hat Auswirkungen: Sie verhandeln häufiger, werden eher befördert und steigen selbstbewusster in Gehaltsgespräche ein.
Frauen hingegen wählen laut Nguyen-Kim häufiger Berufe oder Arbeitsmodelle, die Vereinbarkeit mit Familie ermöglichen – etwa Teilzeit oder Pflegeberufe. Diese sind schlechter bezahlt und werden gesellschaftlich geringer geschätzt.
Gender Pay Gap: Ein Problem, das mit der Zeit wächst
Wie stark sich die Lohnlücke mit der Zeit vergrößert, zeigt Nguyen-Kim in ihrem Buch anhand einer Langzeitstudie der University of Chicago Booth School of Business.
Diese untersuchte die Gehaltsentwicklung von Männern und Frauen mit vergleichbarer Managementausbildung. Bereits beim Berufseinstieg verdienten die männlichen Absolventen im Schnitt rund 130.000 US-Dollar, während ihre weiblichen Kolleginnen mit durchschnittlich 115.000 US-Dollar starteten – eine Differenz von 11,5 %.
Neun Jahre später hatte sich dieser Abstand drastisch vergrößert: Männer verdienten durchschnittlich 400.000 US-Dollar, Frauen hingegen nur 250.000 US-Dollar. Der Gender Pay Gap war auf 37,5 % angewachsen.
Diese Entwicklung lässt sich nicht mit Leistung oder Bildungsniveau erklären. Vielmehr zeigen die Forschenden: Strukturelle Faktoren spielen eine entscheidende Rolle.
Gleiche Qualifikation, weniger Gehalt: Die Lücke ist real – und messbar.
Ab einem gewissen Alter – etwa ab 40 – beginnt sich die Lücke bei den Einkommen zwar teilweise wieder zu verringern, etwa wenn Frauen nach Familienphasen wieder ins Berufsleben stärker einsteigen. Doch aufgeholt wird der Rückstand selten. Was in den ersten Berufsjahren an Gehalt und Aufstiegschancen verloren geht, lässt sich später meist nicht mehr wettmachen – mit langfristigen Folgen bis ins Alter.
Insgesamt gilt also: Frauen unterbrechen ihre Karriere häufiger, reduzieren die Arbeitszeit oder übernehmen den Großteil der familiären Sorgearbeit. Gleichzeitig steigen sie seltener in Führungspositionen auf – oft auch deshalb, weil Männer schon zu Beginn der Karriere mehr verdienen und Paare sich bei der Familienplanung finanziell „rational“ für das höhere Gehalt entscheiden.
Was auf den ersten Blick nach freier Wahl aussieht, ist bei genauerem Hinsehen eine Entscheidung unter ungleichen Voraussetzungen.
Unser Verhalten prägt das Gehirn – und umgekehrt
Ein besonders aufschlussreiches Kapitel in „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit” erklärt, wie unser Gehirn auf Erziehung und gesellschaftliche Rollen reagiert. Das Schlüsselwort lautet: Neuroplastizität – unser Gehirn verändert sich durch Erfahrungen und äußere Einflüsse. Natürlich spielen auch unsere Gene eine Rolle, aber wie sich unser Gehirn und Verhalten entwickeln, hängt vor allem davon ab, was wir erleben und lernen.
Wenn Mädchen lernen, still, hübsch und hilfsbereit zu sein, und Jungs, stark und durchsetzungsfähig, hinterlässt das nicht nur Spuren im Verhalten, sondern auch in der Physiologie des Gehirns. Nicht weil sie biologisch so „programmiert“ wären, sondern weil sich gesellschaftliche Erwartungen körperlich einprägen.
Wie Nguyen-Kim eindringlich erklärt: Unsere „Festplatte“ ist eben keine feste – wie ein biologischer Computer verändert sich das Gehirn ständig, speichert, löscht und vernetzt neu. Je nachdem, welche Erfahrungen wir machen und wie wir leben. Sogar im Erwachsenenalter können neue Gehirnzellen entstehen – vor allem dann, wenn wir besonders intensiven äußeren Reizen ausgesetzt sind, etwa durch Stress, Isolation oder emotionale Belastungen.
Unser Gehirn reagiert auf unser Verhalten – und unser Verhalten entspringt wiederum unserem Gehirn.
 Sie bringt Wissenschaft unterhaltsam auf den Punkt: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist promovierte Chemikerin, Bestsellerautorin und bekannte Wissenschaftsjournalistin
Sie bringt Wissenschaft unterhaltsam auf den Punkt: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist promovierte Chemikerin, Bestsellerautorin und bekannte WissenschaftsjournalistinFoto: Wikipedia/Steffen Prößdorf
Was wir ändern können – und müssen
Um Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu verwirklichen, müssen wir strukturelle Ungleichheiten klar benennen und aktiv verändern. Ungleiche Löhne bei gleicher Leistung und die unsichtbaren Mechanismen, die Frauen langfristig bremsen, sind kein Naturgesetz – sondern Folge gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und bewusster Entscheidungen.
Politik, Unternehmen und Gesellschaft stehen gemeinsam in der Verantwortung, Arbeitszeitmodelle zu schaffen, die Eltern – Müttern und Vätern – eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Ebenso bedarf es einer fairen Bezahlung, insbesondere in sozialen und pflegenden Berufen.
Auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung bestätigen: Gesellschaft prägt unser Verhalten – und dieses Verhalten formt wiederum unser Gehirn. Wer also annimmt, Rollenbilder seien einfach „so“, unterschätzt die Kraft von Sozialisation, Kultur und Politik.
Veränderung ist möglich. Und wie Dr. Mai Thi Nguyen-Kim eindrücklich zeigt, beginnt sie mit dem Willen, genau hinzuschauen und die Strukturen zu hinterfragen, die Ungleichheit aufrechterhalten.
Buchinfo
„Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit – Wahr, falsch, plausibel?” von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim erschien 2021 im Droemer Verlag und ist ein Spiegel-Bestseller auf Platz 1.
Wer mehr erfahren und über weitere gesellschaftliche Fragestellungen wie Drogen, Gewalt, Videospiele, Corona und viele andere spannende Themen lesen möchte, findet das Buch als gebundene Ausgabe, E-Book oder Hörbuch – unter anderem auf Amazon:
https://www.amazon.de/Die-kleinste-gemeinsame-Wirklichkeit-wissenschaftlich/dp/3426278227