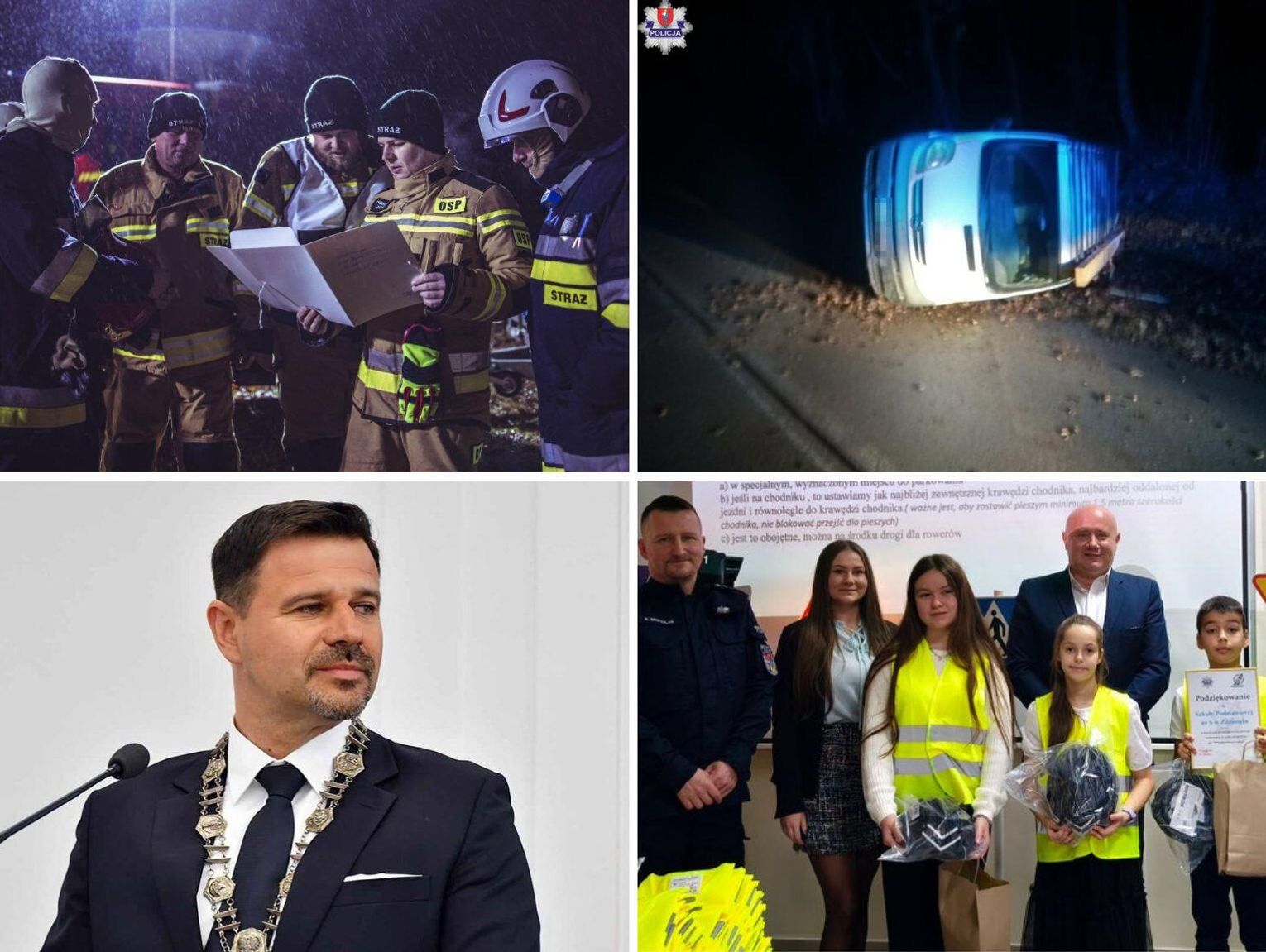Der Duft des Himmels
Jedes Jahr am 15. August, dem Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel, kann man in vielen katholischen Gemeinden ein besonderes Bild beobachten: Menschen bringen bunte, duftende Sträuße aus Kräutern, Blumen und Getreide zur Kirche, um sie segnen zu lassen. Doch was verbindet dieses bedeutende Marienfest, das oft auch Mariä Himmelfahrt genannt wird, mit dem alten Brauch der Kräuterweihe? Die Antwort liegt in einer tiefen Verbindung von Glaube, Natur und einer wunderschönen Legende.
Ein Fest der Hoffnung: Die Aufnahme Marias in den Himmel
Mariä Himmelfahrt ist das älteste und ranghöchste Marienfest der katholischen Kirche. Es feiert den Glauben, dass Maria, die Mutter Jesu, nach ihrem irdischen Leben nicht den leiblichen Verfall erfuhr, sondern mit Leib und Seele in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wurde. Sie ist damit der erste Mensch, der vollendet an der Auferstehung ihres Sohnes teilhat.
Obwohl die Heilige Schrift nicht explizit davon berichtet, ist diese Überzeugung eine aus dem Glauben der frühen Kirche erwachsene Gewissheit, die bis ins 5. Jahrhundert zurückreicht. Papst Pius XII. erhob sie im Jahr 1950 schließlich zum Dogma. Das Fest ist somit nicht nur ein Gedenktag für Maria, sondern vor allem ein Fest der Hoffnung für alle Gläubigen – eine Verheißung, dass auch für uns am Ende des Lebens die Vollendung bei Gott wartet.
Vom leeren Grab zum duftenden Kräuterstrauß
Die Verbindung zur Kräuterweihe stiftet eine wunderschöne Legende. Als die Apostel das Grab Marias öffneten, so erzählt man sich, fanden sie ihren Leichnam nicht mehr vor. Stattdessen sollen dem Grab blühende Blumen und heilsame Kräuter entwachsen sein, von denen ein himmlischer Duft ausging.
Dieses Bild wurde zum Symbol: Maria selbst wird als reinste “Blume des Himmels” oder “Rose ohne Dornen” verehrt, und die Kräuter stehen für die heilsame Kraft, die von Gott ausgeht und sich in seiner Schöpfung widerspiegelt. Der Brauch der Kräuterweihe hat aber auch tiefere Wurzeln, die möglicherweise in vorchristliche Erntefeste zurückreichen, bei denen den Göttern für die Gaben der Natur gedankt wurde. Die Kirche hat diese Tradition aufgegriffen und mit neuem, christlichem Inhalt gefüllt: Der Dank für die Schöpfung und ihre Heilkraft richtet sich nun an Gott, den Schöpfer allen Lebens.
Der Kräuterbuschen: Schutz und Segen aus der Natur
Traditionell werden die Kräuterbuschen aus einer bestimmten Anzahl von Pflanzen gebunden. Oft sind es sieben (in Anlehnung an die sieben Schöpfungstage), neun (drei mal drei für die Dreifaltigkeit) oder zwölf (für die zwölf Apostel).
Eine zentrale Rolle spielt oft die majestätische Königskerze, die als Symbol für Maria selbst gilt. Daneben finden sich je nach Region Johanniskraut, Schafgarbe, Kamille, Salbei, Baldrian und Getreideähren. Nach der Segnung im Gottesdienst werden die Sträuße mit nach Hause genommen und an einem besonderen Ort aufbewahrt, etwa im Herrgottswinkel, auf dem Dachboden oder im Stall. Sie sollen Haus und Hof vor Krankheit, Unwetter und Blitzschlag schützen. Früher wurden Teile davon als Heiltees, schützendes Räucherwerk oder als heilsame Beigabe für das Viehfutter verwendet.
Mariä Himmelfahrt ist somit weit mehr als ein abstraktes Dogma. Es ist ein Fest, das Himmel und Erde, den Glauben an die Auferstehung und die Dankbarkeit für die Schöpfung auf wunderbare Weise verbindet. Der Duft der gesegneten Kräuter, der an diesem Tag die Kirchen und Häuser erfüllt, wird so zu einer jährlichen Erinnerung an die Schönheit der Natur und an die große christliche Hoffnung, dass unser Leben – wie das Mariens – bei Gott seine duftende Vollendung findet.