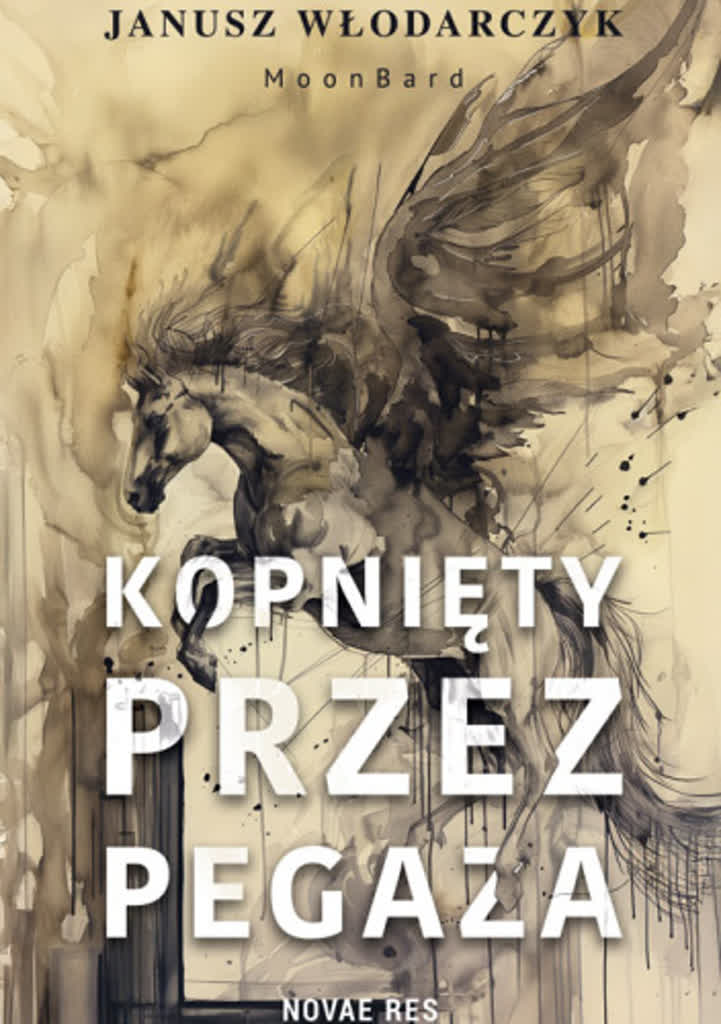Potulitz/Potulice. Vom Sinn des Todes und von der Liebe
Jedes Jahr wird in Potulitz bei Bromberg/Bydgoszcz des menschlichen Leidens gedacht. Unter dem Namen Sammellager Schloss Potulitz, auch Lebrechtsdorf, war dort von 1941 bis 1945 ein deutsches Lager für polnische Familien in Betrieb, und in den Jahren 1945–1950 an derselben Stelle ein polnisches Lager für Deutsche. Die Gedenkfeier am 30. August war anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes und des 75. Jahrestages der Schließung des Lagers besonders feierlich.
Der Bibeltext des ökumenischen Gottesdienstes in der Kirche Mariä Verkündigung in Potulice war treffend gewählt: der Prophet Hesekiel wandelt über eine Menge ausgetrockneter Gebeine auf einem Schlachtfeld. Pfarrer Marek Dziony aus Oppeln näherte den über 60 Gästen die Fragen, die auch heute noch entstehen, obwohl die Toten des Lagers bestattet wurden:
„Er fragte nach dem Sinn des Todes und danach, warum Menschen anderen so etwas antun. Die Antwort auf den zweiten Aspekt ist einfach: Es ist meist Hass, Rache, Streben nach Dominanz, Neid oder Stolz.“
Fünf Stationen für 60.000 Insassen und über 5.000 Tote
Gemeinsam mit seinem evangelischen Amtsbruder Dawid Mendrok begleitete er die Teilnehmer der vom Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) organisierten Veranstaltung zu den Gedenkorten in Potulitz. Von der Kirche aus führte der Weg – für Erstbesucher verwirrend – scheinbar in alle Himmelsrichtungen.

Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Mariä Verkündigung in Potulitz
Foto: Uwe Hahnkamp
Die erste Station war das bekannte Massengrab für die Toten des Nachkriegslagers in der Sand- und Kiesgrube nördlich der Kirche. Andreas Gehrke von der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Graudenz sprach dort nicht nur über seine in den späten 1940er Jahren gestorbenen Familienmitglieder, sondern wies auch auf Schwierigkeiten beim Gedenken hin:
„Es gibt hier noch zwei andere Massengräber, deren Lage vermutet wird, aber es gibt keine Initiative von oben, dort aktiv zu werden.“
„Professor Józef Tischner hat gesagt, dass nicht Leid den Menschen veredelt, sondern die Liebe. Erst dann gibt das Leiden und der Tod der Menschen einen Sinn.“
Rund 35.000 Deutsche, überwiegend Frauen und Kinder, durchliefen das Arbeitslager, die Zahl der Toten beläuft sich auf über 3.500. Gehrke äußerte zudem Sorge über den Zustand des Zufahrtsweges zum Kreuz und Gedenkstein: „Wenn es geregnet hat, ist es fast unmöglich zu passieren. Wir bitten schon lange um einen befestigten Weg, aber es geschieht nichts.“ Ein weiteres Anliegen sind mögliche Exhumierungen, die laut Planung der Bromberger Abteilung des Instituts für nationales Gedenken (IPN) in die Nähe von Stettin/Szczecin verbracht werden sollen, wodurch Angehörigen eine Erinnerung am Ort des Geschehens entzogen würde.
Gedenken an alle Opfer und das Leid der Kinder
Anschließend gingen die Gäste, darunter Vertreter der lokalen Behörden, des IPN und die Beauftragte des Marschalls von Kujawien-Pommern für Minderheitenfragen Iwona Zielińska, ins Stadtzentrum. Dort markiert ein Gedenkstein aus dem Jahr 2002 den Ort des Tores zum früheren Lager, pikanterweise zehn Meter vom Eingang zur heutigen Vollzugsanstalt entfernt, die das Gelände nach Aufgabe des Nachkriegslagers übernommen hat.
„Auf der Tafel werden leider nur die polnischen Opfer des deutschen Lagers erwähnt und die andere Zeit verschwiegen“, bedauert Andreas Gehrke. Wie an allen vier Denkmälern wurden auch hier Blumen niedergelegt und Grabkerzen entzündet.
 Andreas Gehrke aus Graudenz bei seiner Ansprache am Gedenkort für die deutschen Opfer des polnischen Lagers beim Massengrab im Kieswerk
Andreas Gehrke aus Graudenz bei seiner Ansprache am Gedenkort für die deutschen Opfer des polnischen Lagers beim Massengrab im KieswerkFoto: Uwe Hahnkamp
Der Rundgang endete mit einem Gebet am Denkmal der Opfer des Faschismus auf dem Friedhof von Potulitz, am Gedenkstein für die deutschen Opfer, errichtet 1998 von Überlebenden des Lagers. In seinem Grußwort erinnerte der Vorsitzende des VdG, Rafał Bartek, an die Toten beider Seiten: in Potulice starben während der Zeit des Lagers als Unterlager des KZ Stutthof etwa 1.500 von rund 25.000 Menschen.
„Wir sehen, wie groß das Ausmaß dieser Ereignisse war. Es zeigt, dass die Spirale von Rache und Gewalt immer zu weiterem Leid unschuldiger Menschen führt“, so Bartek.
 Gedenken im Stadtzentrum von Potulitz am Stein für die polnischen Opfer des deutschen Lagers
Gedenken im Stadtzentrum von Potulitz am Stein für die polnischen Opfer des deutschen LagersFoto: Uwe Hahnkamp
Abgeschlossen wurde die Feier am zentralen Verwaltungsgebäude der beiden Lager. Zurück zur Kirche im Park des Schlosses der Familie Potulicki, zum Schloss selbst, das heute unter anderem die Stadtbibliothek beherbergt, als fünfte Station. Ein deutlicher Kontrast: Im sonnigen Park tobten Kinder auf den Schaukeln, während Dr. Izabela Mazanowska vom IPN Bromberg beim Vortrag über das große Leid der Kinder sprach.
 Gruppenphoto der Teilnehmer
Gruppenphoto der TeilnehmerFoto: Uwe Hahnkamp
Gustav Becker, damals neun Jahre alt, schilderte in einer 20-minütigen Reportage seine Erlebnisse im Lager. Er erinnerte sich an eine Polin, die bei seiner Familie arbeitete:
„Sie sollte zur Zwangsarbeit eingezogen werden, aber mein Vater schaffte es, dass sie bleiben konnte. Sie war für mich wie eine zweite Mutter.“
Gunter Berthold Horn aus Greifswald mit seiner polnischen Frau und Irena Hirsch, Vorsitzenden der Minderheit in Lauenburg, besuchten die Gedenkstätte ebenfalls regelmäßig. Jadwiga Dziubek berichtete von persönlichen Familienerfahrungen:
„Als mein Vater als Kaschube nicht zur Wehrmacht wollte und in die Wälder floh, wurde meine Familie hier eingesperrt. Mein Bruder war fünf, er überlebte, meine Schwester war noch nicht drei und starb.“
Bernard Joras, Einheimischer, betonte: „Ich gedenke heute der Opfer bis 1945. Aber auch die späteren verdienen Achtung und Erinnerung; deshalb bin ich hier. Es ist alles Teil einer, wenn auch verdrehten, Geschichte.“
Pfarrer Marek Dziony schloss mit den Worten:
„Professor Józef Tischner hat gesagt, dass nicht Leid den Menschen veredelt, sondern die Liebe. Erst dann gibt das Leiden und der Tod der Menschen einen Sinn.“